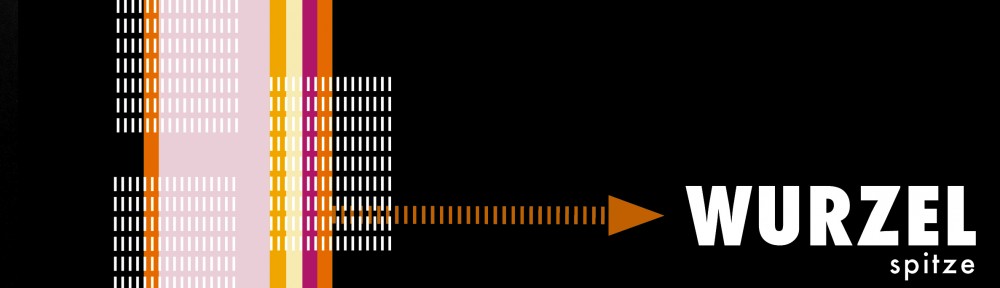Dieser Fall hatte einige Herausforderugen parat.
Zahn 46 mit chronischer Fistelung und großer apikaler Osteolyse und der Zahn 47 mit einer akuten Pulpitis und Caries profunda im distobukkalen, zervikalen Bereich.
Lockerungsgrad 0 – 47, Lockerungsgrad 1 – 46. Die Sondieungstiefen sind zirkulär am Zahn 46 und 47 erhöht ohne vertikalen Einbruch.
Diagnose 47: akute Pulpitis, Sekundärkaries.
Diagnose 46: Z.n. WKB begonnen, P. apicalis
Für alle Kofferdamanwender ist 47 db zervikal eine ungeliebte Situation, da die Kofferdamklammer meistens in der Präparation oder Präparationsgrenze liegt, oder der Kofferdam in der Kavität aufliegt und nicht abdichtet, etc.
Lässt man den Kofferdam weg ist das Risiko von Speichel in der Kavität drastisch höher und die Gefahr eines Leakage stark erhöht.
Unser Vorgehen sieht immer das Anlegen von Kofferdam vor. Sollte es unmöglich sein mit Kofferdam die Kavität zu therapieren, entschließen wir uns ohne Kofferdam, mit relativer Trockenlegung zu arbeiten. Das hat allerdings einen Nachteil, es kann sein, daß durch die Kofferdamklammer die Gingiva traumatisiert wird und eine Blutung dazu kommt.
Dann wird es spannend.
In diesem Fall wurde es spannend, so spannend, daß Fotos nicht gemacht wurden, bzw. vollkommen aus dem Fokus des Behandlers verschwanden. Deshalb haben wir nur Röntgenbilder in diesem Fall.
Zum Fall selbst.
47 wurde auf Grund der akuten irreversiblen Pulpitis zu erst behandelt. Wir haben die Isolation mit modifizierter Butterfly-Klammer Nr. 6 und Teflonband nach Gingivektomie mit dem Elektrotom erreicht. Danach erfolgte der präendodontischer Aufbau mit Beautifil BW, das Gestalten der Zugangskavität, die initiale WK mit NaoCl 3% und Zitronensäure 10%, Sweeps 2x30s und CaOH Einlage.
Der Zahn 46 wurde ebenso (Präendodontischer Aufbau mit Beautifil BW, Gingevektomie m/d, Zugangskavität, WK mit NaoCl 3% und Zitronensäure 10%, Sweeps 2x30s und CaOH Einlage) behandelt. Auf Grund einer puriden Exsudation distal wurde CaOHJ für 4 Wochen in die Kanäle appliziert. Die Wurzelfüllung erfolgte in beiden Zähnen in thermischer vertikaler Kondensation mit Guttapercha und BC Sealer Totalfill.
Die Recalls in 6 Monaten zeigten einen erstaunlichen Heilungsverlauf, den wir in dieser Schnelligkeit am Zahn 46 nicht erwartet hatten. Auf Grund der chronischen apikalen, puriden Exsudation waren wir zurückhaltend in der Prognose.
Auffallend an beiden Zähnen ist die Sealerüberpressung d in die apikalen Gefäße. Wir führen das auf den Einsatz des Lasers mit Sweeps zurück. In beiden Fällen wurde die gleiche Zeit Dauer und „Energiemenge“ eingesetzt. Ein Zeichen, daß es im Einsatz bei vitalen und neurotischen Fällen wohl keinen Unterschied in der „Aktivierung“ des NaOCl durch den Lasers, bei ähnlicher Anatomie gibt.
In der Behandlung des Zahnes 46 im distoapikalen Bereich, ist es uns nicht gelungen die lateralen Kanäle zu sondieren. Obwohl im DVT erkennbar konnten wir trotz ausgiebiger circumferenter Sondierung mit vorgebogenen Handfeilen in #8 und #10 keine laterale Kanalstruktur finden.
Noch eine Anmerkung in merkwürdigen Zeiten: Da bereits die bloße Nennung eines Produktes auf einer Homepage als Werbung interpretiert werden kann, benennen wir diesen Blogbeitrag (wie auch jeden bereits geschriebenen sowie alle zukünftigen Beiträge, in denen Produkte benannt werden) als unbezahlte Werbung. Sollten wir (jemals) finanzielle Zuwendungen von Firmen erhalten, die Erwähnung bestimmter Produkte betreffend, werden wir die entsprechenden Blogbeiträge als „bezahlte Werbung“ ausweisen.
Gefällt mir:
Gefällt mir Wird geladen …